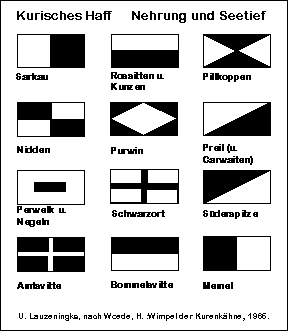Kurenkahnwimpel und Ortskennzeichen
im Kurischen Haff
Die bunten, handgeschnitzten Wimpel auf den Kähnen des Kurischen Haffs sind eines der beliebtesten Motive von Malern und Fotografen gewesen. In der der uns bekannten Form existieren sie erst seit der Jahrhundertwende. Begonnen hat alles 1844, als eine neue Fischereiordnung erlassen wurde. Die Königliche Regierung war schon lange unzufrieden damit, dass die Fischer sich nicht an die damalige Haffordnung hielten und fischten, wie und wann es ihnen gefiel. Die Regierung betrachtete das als Raubfischerei, die Fischer hielten es für ihr gutes Recht auf freie Fischerei.
Die Fischerei sollte eingeschränkt werden, "um der Verminderung
des Fischbestandes in beiden Gewässern entgegen zu wirken und diese wichtige
Nahrungs- und Erwerbsquelle ergiebiger zu machen."1. Damit
war unter anderem gemeint: die Schonzeiten für verschiedene Fischarten einzuhalten,
keine zu engmaschigen Netze zu verwenden oder in Laichrevieren zu fischen.
Der Laich, der sofort wieder in Wasser geworfen werden mußte, falls man
zufällig welchen im Netz hatte, wurde nicht nur an Schweine und Hühner verfüttert,
sondern sogar auf den Märkten feilgeboten. Der einzige Fischmeister, den
es 1834 für das gesamte Kurische Haff gab, konnte dem natürlich nicht beikommen.
Das sollte sich jetzt ändern: nach langen Vorbereitungen wurde zuerst die
Zuständigkeit für beide Haffe einer Behörde übergeben - der Regierung in
Königsberg; zuvor waren Königsberg, Gumbinnen und Danzig jeweils nur für
ihre Haffteile zuständig.
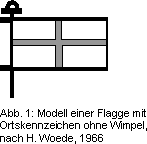
Es wurde eine Liste der vorgesehenen Flaggen - ein Flaggenbuch - veröffentlicht und an alle Ortsvorstände und Fischerschulzen, wie man heute sagen würde, weitergeleitet. Die Fischereiberechtigten hatten nun sechs Wochen Zeit, ihre neue Flagge auf den Mast zu bringen. Die Kennzeichen sollten mit der Farben- und Flächenaufteilung dazu dienen, von weitem und möglichst auch in der Dämmerung sichtbar und unterscheidbar zu sein. Da die Fischmeister auch nur mit Wind- und Segelkraft unterwegs waren, und damit auch nicht schneller als die Fischer, war ihnen daran gelegen, eventuelle Übeltäter von weitem erkennen zu können. Die Zusammenstellung der geometrischen Zeichen war willkürlich und hatte keine tiefere Bedeutung.
Es gibt daher das gleiche Muster für mehrere Orte nur in unterschiedlichen
 Farbenzusammenstellungen;
z.B. ein dunkles Kreuz auf hellem Grund in Schwarz-Weiß für Schwarzort auf
der Kurischen Nehrung, in Rot-Weiß für Gilge an der Südostküste des Kurischen
Haffs und in Gelb-Blau für Neufitte an der Samlandküste und in Rot-Blau für
Laxdehnen am Frischen Haff.
Farbenzusammenstellungen;
z.B. ein dunkles Kreuz auf hellem Grund in Schwarz-Weiß für Schwarzort auf
der Kurischen Nehrung, in Rot-Weiß für Gilge an der Südostküste des Kurischen
Haffs und in Gelb-Blau für Neufitte an der Samlandküste und in Rot-Blau für
Laxdehnen am Frischen Haff. In der Fischereiordnung von 1917 wurde zwar die Führung der Ortsflaggen noch vorgeschrieben, aber im täglichen Umgang wurden die Kennzeichnungen an den Bootsflanken und Segeln wichtiger als die Flaggen. 1936 z.B. hatten sich Fischer aus Gilge und Labagienen in dem neu entstandenen Ort Julienhöhe niedergelassen. Die Königsberger Regierung wollte für diesen Ort keine neue Flaggenregelung mehr treffen, und so führten die Fischer weiter ihre alten Ortsflaggen in ihren Wimpeln.
Zusammenfassend kann man sagen: "Das Zeigen der Ortschaftsflaggen - einst oft nur unter obrigkeitlichem Zwang durchgesetzt - war im Laufe eines Jahrhunderts zu einem echten Volksbrauch geworden."2
1 Woede, Hans: Die Wimpel der Kurenkähne.
Geschichte - Bedeutung - Brauchtum.. Würzburg: 1966, Holzner Verlag. Seite
37.
2 AKRK, 1844, zitiert nach Woede, Seite 38
ebd. Seite 53.